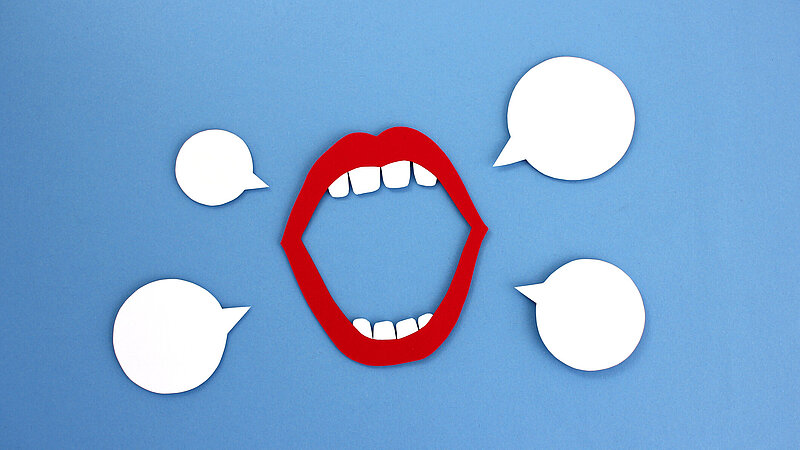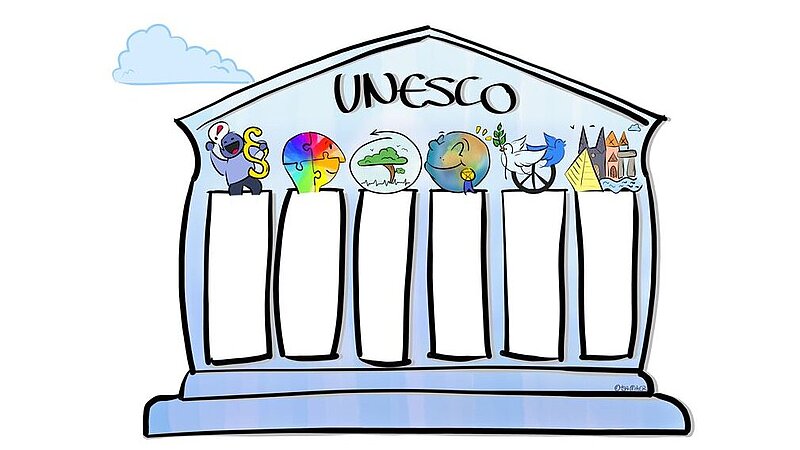Pädagogische Grundsatzthemen
Wir bieten Unterstützung für vielfältige pädagogische schulart- und fächerübergreifende Themen. Dabei zeigen wir Schnittmengen auf und geben Anregungen für die Umsetzung der Schulart- und fächerübergreifenden Bildungsziele.
Unser Angebot reicht von Handreichungen über Themenportale bis hin zu konkreten Unterrichtsbeispielen:
- Schulentwicklung
-
Pädagogische Grundsatzthemen
- Alltagskompetenzen
- Bayern gegen Antisemitismus
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- BLKM
- Dialekte
- Familie und Schule
- Gesundheit und Schule
- Individuelle Förderung
- Kompetenzorientierung und LehrplanPLUS
- Kulturelle Bildung
- Ökonomische Verbraucherbildung
- Leseförderung
- MINT-Förderung
- Politische Bildung
- Prävention
- SMV
- Schülerzeitung
- Talent im Land – Bayern
- UNESCO-Projektschulen
- Wertebildung
- Qualitätsentwicklung
- EU-Bildungsprogramme
- Ganztag
- Bildungsforschung
- Kontakt
Ihre Ansprechperson
Weitere Ansprechpersonen